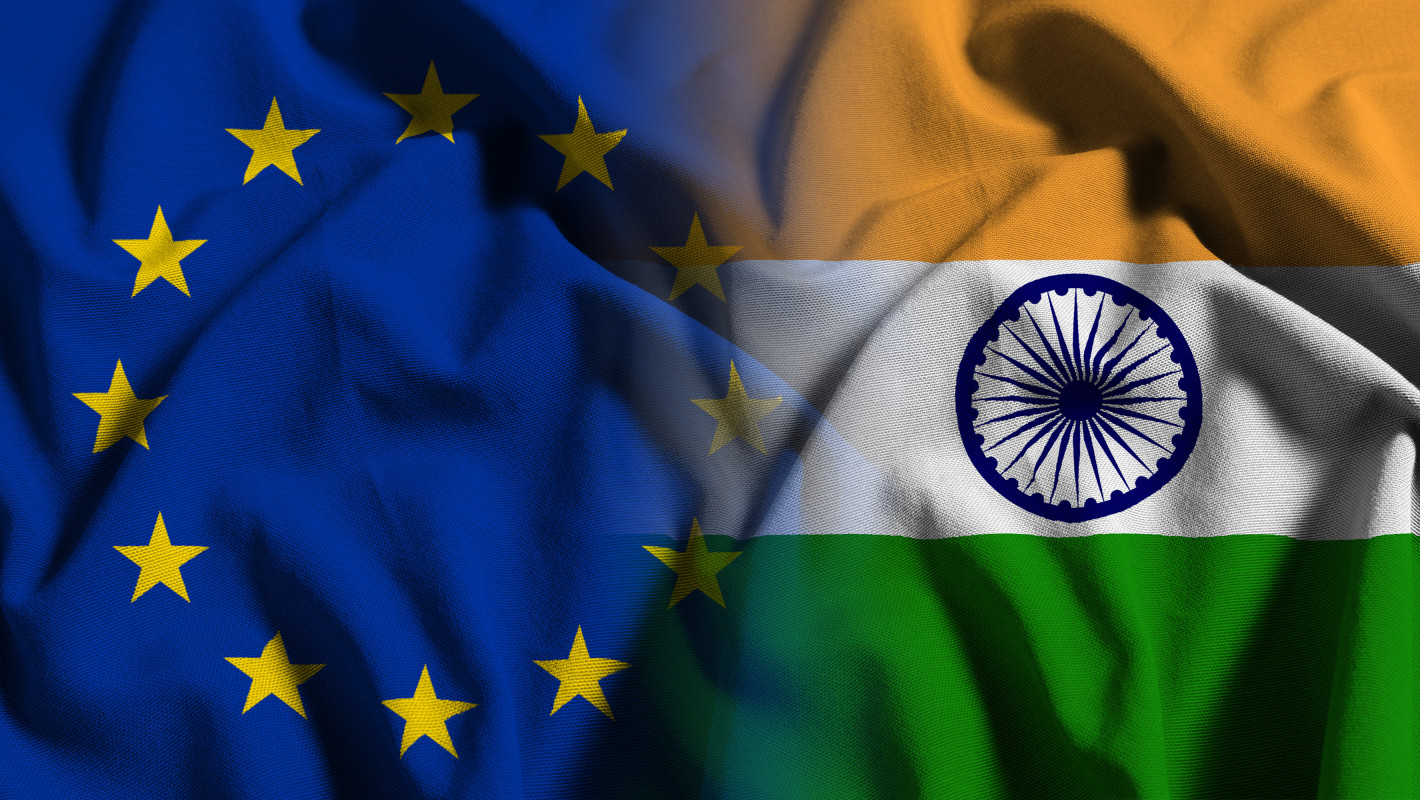Gehaltsknick bei Müttern viel größer als gedacht
Beitrag für den Newsletter Finanzbildung mit Wissen rund um Wirtschafts- und Geldthemen

Der sogenannte Gender Pay Gap ist schon seit längerem Gegenstand zahlreicher Diskussionen und Analysen. Der englische Begriff bezeichnet allgemein den Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern. Konkrete Zahlen hierzu werden einmal im Jahr vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Tendenz der vergangenen Jahre: Die Lohnlücke hat sich in Deutschland kaum verändert, Männer verdienen nach wie vor mehr als Frauen.
Bereinigter und unbereinigter Gender Pay Gap
Unterschieden wird dabei zwischen dem bereinigten und dem unbereinigten Gender Pay Gap. Während Letzterer den Verdienstunterschied zwischen allen Männern und Frauen anzeigt, unabhängig von Faktoren wie Branche, Berufserfahrung, Führungsposition oder Arbeitszeit, berücksichtigt der bereinigte Gender Pay Gap den Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen, die vergleichbare Qualifikationen und Tätigkeiten ausüben. Das bedeutet: Die Lohndifferenz von ca. 20 Prozent beim unbereinigten Gender Pay Gap lässt sich darauf zurückführen, dass Frauen überdurchschnittlich häufig in weniger gut bezahlten Branchen (etwa im Einzelhandel) arbeiten als Männer. Beim bereinigten Gender Pay Gap hingegen, der 2024 bei ungefähr 6 Prozent lag, fällt die Antwort auf die Frage, warum Männer mehr verdienen als Frauen, schon schwerer.
Eine neue Studie des Mannheimer Instituts ZEW nähert sich der Frage nach den Einkommensdifferenzen nun von einer anderen Seite: Sie vergleicht nicht die Gehälter von Männern und Frauen miteinander, sondern von kinderlosen Frauen mit Müttern vier Jahre nach der Geburt. Ergebnis: Die große Gehaltslücke klafft heutzutage nicht mehr zwischen den Geschlechtern per se, sondern zwischen Müttern und kinderlosen Frauen. Sobald das erste Kind zur Welt kommt, bricht das Einkommen der Mütter ein und verläuft langfristig auf einem niedrigeren Pfad als bei kinderlosen Frauen und Männern.
30.000 Euro weniger
Das in der Wissenschaft als „motherhood penalty“ bekannte Phänomen ist in Deutschland dabei noch viel größer als bislang vermutet. „Mütter verdienen im vierten Jahr nach der Geburt durchschnittlich fast 30.000 Euro weniger als gleichaltrige Frauen noch ohne Kinder“, schreiben die Forscher Valentina Melentyeva und Lukas Riedel, womit die Lücke fast um ein Drittel größer sei als in den bisherigen Schätzungen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des ZEW werteten für ihre Studie amtliche deutsche Daten von mehr als 186.000 Müttern aus, die zwischen 1975 und 2021 erhoben wurden. Ihre Forschungsmethode unterscheidet sich dabei von früheren Auswertungen: Wurden die Gehälter von Müttern bislang nicht nur mit Gehältern von Frauen verglichen, die noch kein Kind bekommen haben, sondern häufig auch mit Frauen, die schon Kinder hatten, ist diese Schwachstelle jetzt behoben worden.
Wie die Studie konkret zeigt, schrumpft der jährliche Bruttoverdienst der Mütter vier Jahre nach der Geburt des Kindes im Schnitt um weit mehr als die Hälfte, wobei Frauen, die mit 31 Jahren Mutter werden, die größten absoluten Einbußen hinnehmen müssen. Relativ gesehen sind die Einbußen bei jüngeren Müttern aber sogar noch größer. Ganz anders sieht die Lage bei den Männern aus: Frühere Studien zeigen, dass sie im Schnitt sogar beruflich davon profitieren, wenn sie Vater werden, da sie von ihren Arbeitgebern dann als zuverlässiger eingeschätzt werden.
Ungleiche Verteilung der Teilzeit
Dass zwei Drittel der Mütter von minderjährigen Kindern zuletzt in Teilzeit arbeiteten, aber nur ein Zehntel der Väter ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die Erfahrung des Gehaltsknicks eine einseitig weibliche ist. Der Grundstein hierfür wird in den ersten Monaten und Jahren nach der Geburt gelegt: Während Frauen im Schnitt 11,6 Monate Elterngeld beziehen, sind es bei den Männer lediglich 2,8 Monate. Nur vier von zehn Müttern von Kindern unter drei Jahren waren zuletzt in Deutschland überhaupt erwerbstätig. Und auch danach kehrt die Mehrheit der Frauen – siehe oben – nicht voll in den Job zurück. All das habe „langfristige Auswirkungen auf Karriere und die spätere Rente“ der Frauen, schreiben die Forscher und Forscherinnen.
In Deutschland fallen die Lohneinbußen im internationalen Vergleich dabei besonders groß aus; sowohl in den skandinavischen Ländern als auch in Frankreich und den Vereinigten Staaten sind sie deutlich geringer. Forscher erklären das mit nach wie vor nicht ausreichend vorhandenen Betreuungsangeboten für kleine Kinder sowie mit den vergleichsweise traditionellen Rollenbildern in Deutschland: Betreuungsaufgaben und Hausarbeit fallen überproportional häufig in die Verantwortung der Frauen.
Bewusstsein schaffen
Was könnte dazu beitragen, die Einkommenseinbußen in Deutschland zu reduzieren? Neben verbesserten Kinderbetreuungsangeboten und Anpassungen beim Elterngeld geht es auch um Aufklärung, so das ZEW. Existierende Studien würden zeigen, dass viele Frauen nicht wissen, welche Folgen es mit Blick auf ihre Karriere und Einkommen habe, wenn sie Mutter werden. Wenn dies bekannter sei, würden Frauen stärker darauf drängen, wieder in Vollzeit in den Beruf zurückzukehren, zeigten Beispiele aus der Schweiz.