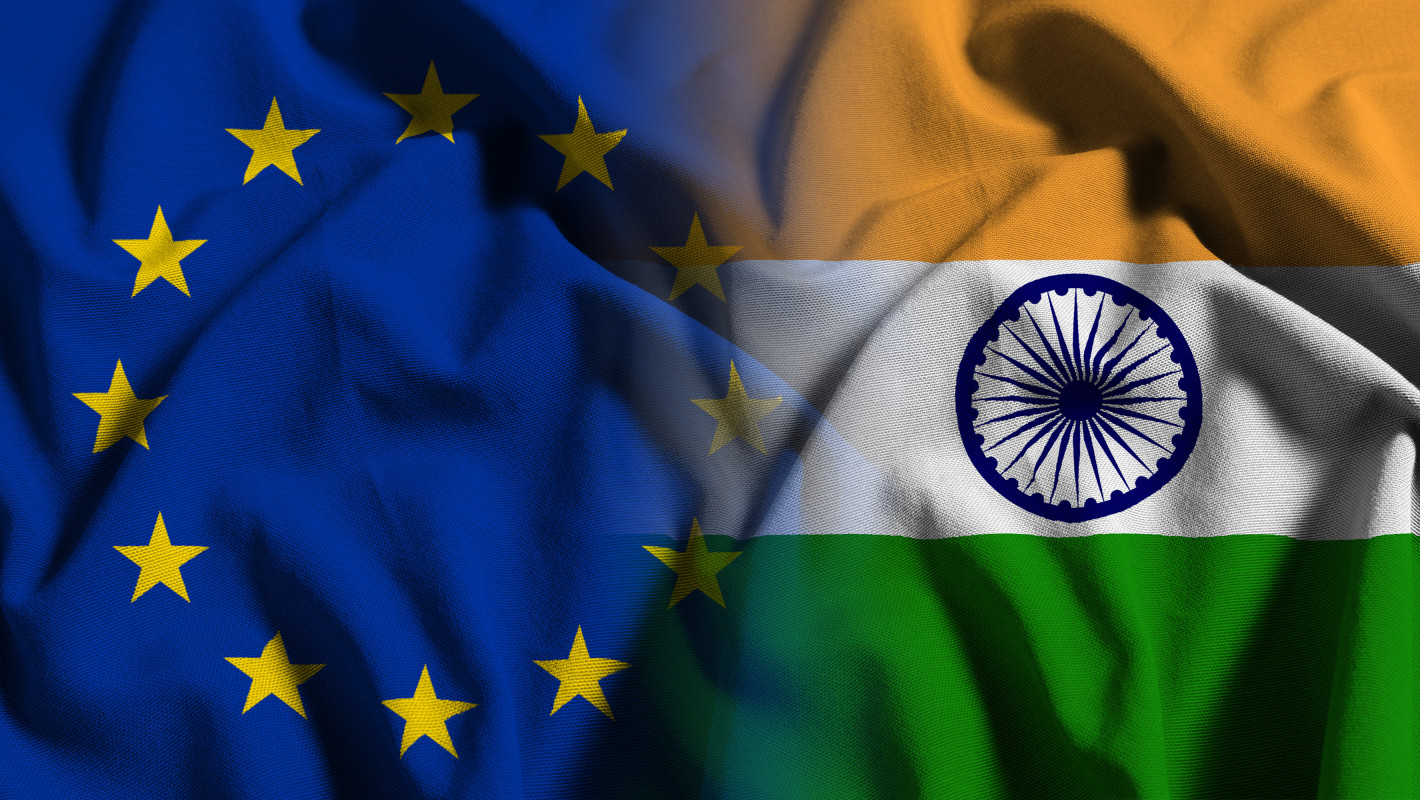Schlechtes Zeugnis für den Innovationsstandort Deutschland
Beitrag für den Newsletter mit Wissen rund um Wirtschafts- und Geldthemen

Eine neue Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI) zeigt, dass das Vertrauen in die Innovationskraft des Standorts Deutschland gering ist. Befragt wurden 274 Unternehmen des produzierenden Gewerbes in Deutschland mit mindestens 250 Beschäftigten.
Keine guten Rahmenbedingungen
Innovationen sind der Schlüssel für steigenden Wohlstand und eine zunehmende Produktivität. Umso mehr fällt ins Gewicht, dass 57 Prozent der befragten Unternehmen die Rahmenbedingungen für ihre eigenen Innovationsaktivitäten als weniger oder gar nicht gut einschätzen. Und zugleich kritisieren knapp zwei von drei Unternehmen, dass ausländische Unternehmen es leichter hätten, neue Ideen umzusetzen.
Als Haupthindernis für Innovationen nennen die Verantwortlichen strenge gesetzliche Vorgaben und Regulierung (76 Prozent) sowie lange Genehmigungsverfahren (62 Prozent). Zudem sind viele Unternehmen skeptisch, ob Deutschland seinen Wettbewerbsrückstand schnell aufholen kann – 60 Prozent schätzen die Chancen dafür als gering ein. Vor allem die komplexe Regulierung habe Folgen: Statt Innovationen voranzutreiben, so der BDI, sichern sich Unternehmen und die kreativen Köpfe ab und vermeiden Risiken.
Forschung geht zunehmend ins Ausland
Immerhin scheitern Innovationen in den meisten Fällen nicht am Geld, so ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Demzufolge ist die Gruppe der Unternehmen, die ihr Budget für Forschung und Entwicklung in den vergangenen drei Jahren erhöht hat, größer als die Gruppe mit schrumpfenden Forschungsbudgets. Und auch für die Zukunft rechnen die meisten Befragten mit steigenden Budgets. Haken an der Sache: Dieses Geld wird zunehmend im Ausland investiert.
20 Prozent der befragten Unternehmen geben an, den Bereich Forschung und Entwicklung schon ins Ausland verlagert zu haben, weitere neun Prozent denken darüber nach. Besonders verlagerungsfreudig sind die Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Von ihnen berichten 34 Prozent über eine schon erfolgte Verlagerung. „Die Abwanderung von Forschung und Entwicklung bedroht den Wirtschaftsstandort im Kern. Mit den Innovationen geht auch die Voraussetzung für Wertschöpfung in Deutschland verloren“, kommentiert BDI-Präsident Peter Leibinger diese Entwicklung.
Die Hauptgründe für die Verlagerung sind vor allem geringere Kosten (58 Prozent), weniger Bürokratie im Ausland (47 Prozent) und eine größere Innovationsoffenheit an ausländischen Standorten (34 Prozent). Der Fachkräftemangel hingegen fällt weniger ins Gewicht Die meisten Unternehmen haben damit im Forschungsbereich nach eigenem Bekunden wenig bis gar keine Probleme.
Abhängigkeit bei digitalen Schlüsseltechnologien
Besonders besorgt zeigten sich die Unternehmen über die Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern bei zentralen digitalen Schlüsseltechnologien wie Cloud-Systemen und Künstlicher Intelligenz. Aus Mangel an europäischen Alternativen greifen 63 Prozent der Befragten bei digitalen Schlüsseltechnologien auf Anbieter von außerhalb der EU zurück, ähnlich viele sagen, der technologische Abstand sei in den vergangenen fünf Jahren nicht gesunken, sondern gestiegen. Drei Viertel der Befragten sind alarmiert über die Abhängigkeit von China, gut die Hälfte beunruhigt die Abhängigkeit von den USA.
Für den BDI-Präsidenten sind die Ergebnisse ein Handlungsauftrag für die nächste Bundesregierung. „Unsere Grundlagenforschung ist exzellent“, sagt Leibinger. „Doch zu selten entstehen aus wissenschaftlichen Durchbrüchen erfolgreiche neue Geschäftsmodelle.“ Es brauche eine „strategische Innovationspolitik“ und einen Mentalitätswandel. Der Innovationsindikator 2024 des BDI zeigt derweil, dass Deutschland im internationalen Vergleich nur noch auf Platz 13 liegt - hinter Südkorea, den USA und der Schweiz.