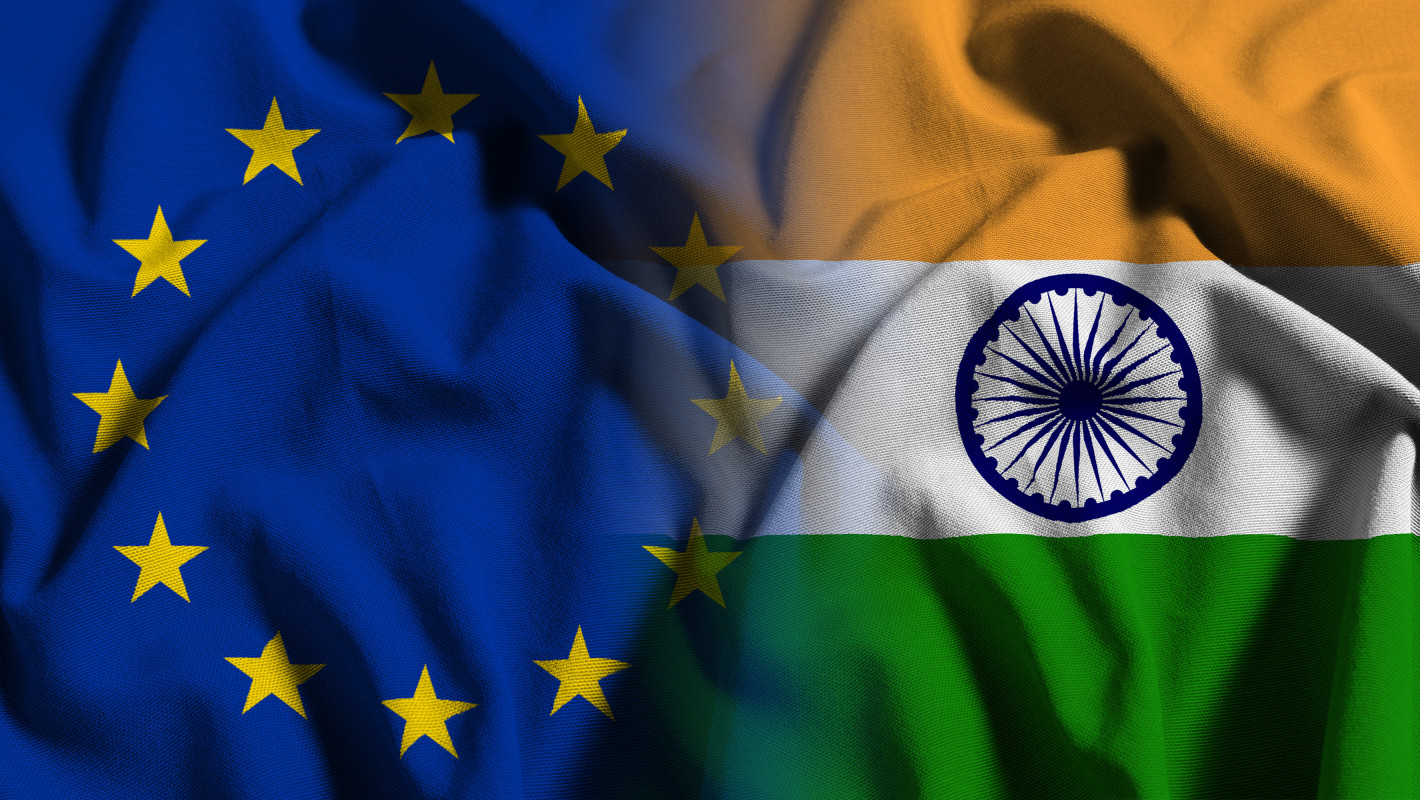Seltene Erden: So wichtig wie knapp
Beitrag für den Newsletter Finanzbildung mit Wissen rund um Wirtschafts- und Geldthemen

Laut Rohstoffpreisindex der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) sind die Preise für Seltene Erden zuletzt deutlich gestiegen und stellen damit eine erhebliche Belastung für die deutsche Industrie dar. Insgesamt hätten sich die Rohstoffe im zweiten Quartal im Vergleich zur vorangegangenen Dreimonatsperiode um fast neun Prozent verteuert. Doch warum ist das ein Problem? Welche Bedeutung haben Seltene Erden für die deutsche Wirtschaft, und was versteht man überhaupt unter diesem Begriff?
Unersetzlich für High Tech
Unter dem Begriff Seltene Erden werden 17 Stoffe zusammengefasst, ohne die viele Hochleistungstechnologien gar nicht denkbar wären. Seltene Erden werden etwa für die Herstellung von Halbleitern und die Produktion von Smartphones und Elektroautos benötigt. Jedes einzelne der Metalle hat Eigenschaften, die es für die Industrie wertvoll machen – teils sind sie sogar unersetzlich. Europium etwa wird für Fernsehbildschirme gebraucht, Cerium zum Polieren von Glas, Lanthan für Katalysatoren in Benzinmotoren. Seltene Erden finden sich auch in Drohnen, Festplatten, Teleskoplinsen oder Raketen. Der größte Bedarf an Seltenen Erden besteht in der Herstellung von Permanentmagneten: Neodym, Samarium, Praseodym, Dysprosium, Terbium und Gadolinium stehen hier an erster Stelle. Ohne diese Permanentmagnete müssten fast alle Kernindustrien Deutschlands ihre Produktionen einstellen. Laut einer Studie werden in Offshore-Windparks bis zu 600 Kilogramm Permanentmagnete verbaut.
Abhängigkeit von China
Offenbar gibt es einen Engpass an Seltenen Erden, denn sonst wären die Preise in jüngster Zeit nicht so gestiegen. Aber woher rührt dieser Engpass? Grundsätzlich ist das Vorkommen an Seltenen Erden gar nicht so gering, wie es der Name suggeriert; manche von ihnen kommen häufiger vor als Blei oder Gold. Problematisch aber ist, dass der Weltmarkt von einem einzelnen Staat beherrscht wird – und zwar von der Volksrepublik China. Mehr als 70 Prozent der weltweiten Förderung und sogar rund 90 Prozent der Weiterverarbeitung sind aktuell in chinesischer Hand. China beherrscht vor allem kritische Zwischenstufen der Produktion und wird dadurch zu einem „strategischen Gatekeeper“ mit großem Einfluss auf Europas wirtschaftliche Zukunft. Die bestehende Lieferabhängigkeit birgt systemische und auch geopolitische Risiken für Europa.
Zuletzt wurde dies vor wenigen Monaten deutlich: Als im Frühjahr der Handelskonflikt zwischen den USA und China hochkochte, kam es de facto zu einem mehrwöchigen Lieferstopp von Seltenen Erden, der auch Europa betraf. Peking führte als Grund für die Lieferengpässe zwar einen Bearbeitungsstau der Anträge an. Doch Insider gehen davon aus, dass die chinesische Regierung ihre Muskeln spielen lassen wollte. Ergebnis: Die Versorgungslage sei auch jetzt noch „angespannt“, sagte jüngst eine Expertin des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) konstatiert: Die Exportlizenzen aus China „reichen nicht aus“.
Wie kam es zu dieser Abhängigkeit? China hat bereits früh die künftige Relevanz Seltener Erden erkannt. Auch weil die Verarbeitung margenschwach ist und oft mit hohen Umweltkosten einhergeht, die für die Volksrepublik ein geringeres Problem darstellen als für Europa, ist es dem „Reich der Mitte“ gelungen, eine Monopolstellung aufzubauen: im eigenen Land – etwa 40 Prozent der weltweiten Vorkommen an Seltener Erde befinden sich in China –, aber auch im Rest der Welt. Inzwischen steht die Volksrepublik relativ allein an der Spitze, was Know-how und Technik bei der Weiterverarbeitung angeht; Experten schätzen den Entwicklungsvorsprung auf zehn bis fünfzehn Jahre. Für lange Zeit hat diese Dominanz hierzulande kaum jemanden gestört, denn China galt als verlässlicher Lieferant, der die europäischen Unternehmen mit günstigen Rohstoffen versorgte. Diese Sorglosigkeit änderte sich erst, als China sein Monopol als Druckmittel gegen ausländische Unternehmen einsetzte und Exportbeschränkungen verhängte.
Strategien für mehr Unabhängigkeit
Was lässt sich gegen diese Abhängigkeit tun? Die Europäische Union hat zwar ein Rohstoffgesetz erlassen und Investitionen in heimische Abbauprojekte beschlossen. Experten und Expertinnen sind sich aber einig, dass die europäische Rohstoff-Souveränität auf drei Säulen fußen muss: neben dem heimischen Abbau, der Raffinerie und der Weiterverarbeitung von Seltenen Erden müssen die Bezugsländer diversifiziert und die Recyclingkapazitäten ausgebaut werden.
Zwei dieser drei Punkte bergen allerdings nur wenig Potenzial. Zum einen sind die europäischen Vorkommen an Seltener Erde nicht annähernd ausreichend. Selbst mit den vor zwei Jahren entdeckten Vorkommen in Schweden – deren Förderung erst in zehn bis 15 Jahren beginnen kann – wird der innereuropäische Abbau nicht mehr als zehn Prozent des europäischen Bedarfs ausmachen. Auch die Bezugsketten-Diversifizierung, also die Suche nach alternativen Handelspartnern, kann nur einen kleinen Teil einnehmen. Selbst bei „nur noch“ 76 Prozent der Weiterverarbeitung in chinesischen Händen im Jahr 2040, wie die IEA (Internationale Energieagentur) schätzt, müssten die übrigen 24 Prozent zwischen allen westlichen Industrien aufgeteilt werden.
Recycling als Lösung?
Bleibt also der massive Ausbau des Recyclings – aktuell werden weniger als ein Prozent des Seltenerd-Schrotts wiederverwertet. Dabei könnten einer Studie der Universität Löwen zufolge allein aus dem Recycling ab 2040 bis zu 65 Prozent des europäischen Bedarfs gedeckt werden. Die Technologien, um diese Zahlen zu erreichen, sind zumindest im Laborstadium schon vorhanden. Doch für die Umsetzung im industriellen Maßstab braucht es einen radikalen Kurswechsel in der Politik: Denn lange Zeit wird das Seltenerd-Recycling ein reines Verlustgeschäft bleiben.
Für den Aufbau der benötigten Recyclingkapazitäten, so die Experten und Expertinnen, müsste die EU einen Rahmen schaffen, der es Unternehmen erlaubt, schnell, koordiniert und unkompliziert in Recyclingforschung und -entwicklung zu investieren. Voraussetzung hierfür sei, dass massive Kapital- und Personalkräfte freigesetzt werden, was angesichts der strategischen Relevanz aber nicht nur Aufgabe der Unternehmen sein könne. Notwendig wäre daher ein System von Subventionen und Anreizen, um die ökonomischen Einstiegshürden zu reduzieren. Und: Die Entscheider in Politik und Wirtschaft müssten begreifen, dass es bei kritischen Rohstoffen wie den Seltenen Erden nicht um kurz- bis mittelfristige Gewinne geht – sondern um den langfristigen Erhalt einer Zukunft für die gesamte europäische Industrie.