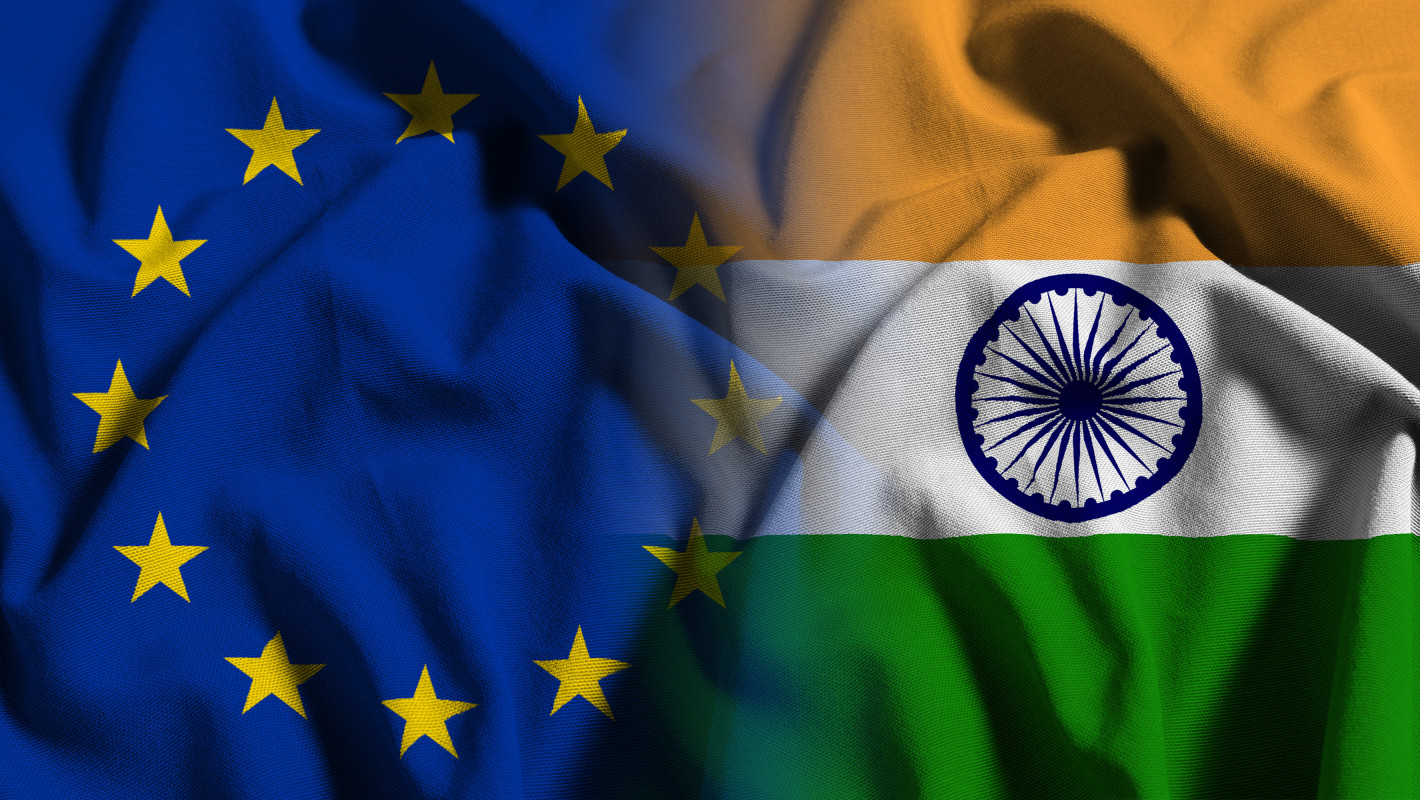Sozialbeiträge werden weiter steigen
Beitrag für den Newsletter mit Wissen rund um Wirtschafts- und Geldthemen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen sich in Deutschland hälftig die Beiträge für die gesetzlichen Sozialversicherungen; dies betrifft die Renten-, die Kranken-, die Arbeitslosen- und die Pflegeversicherung. Die Beiträge verringern das Nettoeinkommen der Arbeitnehmer und treiben die Kostenlast der Unternehmen nach oben, weshalb ihnen auch eine Bedeutung für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes zukommt. Immerhin konnte der Gesamtbeitragssatz lange Zeit unter 40 Prozent des Bruttolohns gehalten werden. Vor zwei Jahren aber, im Januar 2023, hatte er mit 40,45 Prozent erstmals seit 2012 wieder die 40-Prozent-Grenze überschritten. Seitdem sind die Beiträge weiter gestiegen.
Zu Beginn des Jahres 2025 liegt die gesamte Sozialabgabelast der beitragspflichtigen Einnahmen bei inzwischen 42,3 Prozent. Dazu hat vor allem die deutliche Anhebung des Zusatzbeitrages in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zum Jahreswechsel 2025 auf durchschnittlich 2,9 Prozent beigetragen. Damit beträgt der gesamte GKV-Beitragssatz zum Jahresbeginn 2025 durchschnittlich 17,5 Prozent. Der Beitragssatz für die Rentenversicherung beträgt 18,6 Prozent, für die Arbeitslosenversicherung 2,6 Prozent und für die Pflegekasse 3,6 Prozent; letzterer wurde ebenfalls zu Beginn des Jahres angehoben.
2029 erreichen Beiträge fast 46 Prozent
Für die nächsten Jahre müssen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf einen noch stärkeren Anstieg der Sozialabgaben einstellen als bisher erwartet. Eine Studie des Berliner IGES Instituts kommt zu dem Ergebnis, dass die Beiträge bis 2029, also zum Ende der neuen Legislaturperiode, fast 46 Prozent des Bruttolohns erreichen dürften.
In der gesetzlichen Krankenkasse müssen die Versicherten demnach mit einem Anstieg des Kassenbeitrags um 1,4 Prozentpunkte auf 18,5 Prozent bis 2029 rechnen. Der Beitragssatz zur Rente dürfte in den vier Jahren ebenfalls um 1,4 Punkte auf dann 20 Prozent steigen. Und der durchschnittliche Pflegebeitragssatz erhöht sich der Analyse zufolge um 0,6 Punkte auf 4,4 Prozent. Für die Arbeitslosenversicherung wird ein Anstieg um 0,1 Punkte auf 2,7 Prozent erwartet. Die Summe der Beiträge erhöhte sich damit, verglichen mit heute, um weitere 3,5 Prozentpunkte auf 45,8 Prozent. Ein Prozentpunkt macht eine Mehrbelastung der Beitragszahler von rund 17 Milliarden Euro pro Jahr aus.
Demografischer Wandel hauptverantwortlich
Bis 2035 könnten die Beiträge der verschiedenen Versicherungszweige insgesamt sogar auf 48,6 Prozent steigen. Ob es genauso kommen wird, hängt zwar auch von den Entscheidungen der Politik in den kommenden Jahren ab. Doch dass die Beiträge in den kommenden Jahren steigen werden, ist unstrittig. Warum ist das so? In erster Linie hat dies mit dem demografischen Wandel zu tun. Eine alternde Bevölkerung führt zu einer höheren Anzahl von Rentenbeziehern, während gleichzeitig die Zahl der Erwerbstätigen, die in das System einzahlen, abnimmt. Dies belastet die Rentenkassen und erfordert Anpassungen der Beitragssätze.
Zusätzlich steigen die Ausgaben im Gesundheitswesen und in der Pflege, da eine älter werdende Gesellschaft mehr Gesundheits- bzw. Pflegedienstleistungen nachfragt. Die bessere Bezahlung von Pflegekräften, um den anhaltenden Fachkräftemangel zu
bekämpfen, der kostentreibende medizinisch-technische Fortschritt sowie ineffiziente Strukturen der Versorgung und die Honorierung von insgesamt mehr Leistungen treiben Ausgaben und Beitragssätze nach oben.
Maßnahmen gegen den Anstieg der Beiträge
Um zu verhindern, dass die Sozialversicherungsbeiträge in den kommenden Jahren kontinuierlich steigen, sind verschiedene Maßnahmen denkbar. Erstens könnte eine Reform des Rentensystems in Betracht gezogen werden, die Anreize für längeres Arbeiten schafft und die Altersgrenze anpasst. Dadurch würde die Zahl der Beitragszahler erhöht und die Belastung der Rentenkassen verringert.
Zweitens ist eine gezielte Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung wichtig. Durch Investitionen in Bildung und Weiterbildung können mehr Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden, was die Einnahmen der Sozialversicherungen steigert.
Drittens könnte die Effizienz im Gesundheitswesen verbessert werden, um Kosten zu senken. Dies könnte durch digitale Gesundheitslösungen, präventive Maßnahmen und eine bessere Koordination der Versorgung erreicht werden.
Schließlich ist eine diversifizierte Finanzierung der Sozialversicherungen denkbar, etwa durch zusätzliche Einnahmequellen oder eine breitere Steuerbasis, um die Abhängigkeit von den Beiträgen zu reduzieren. Durch diese Maßnahmen könnte eine stabilere finanzielle Grundlage geschaffen werden, die steigende Beiträge verhindert.