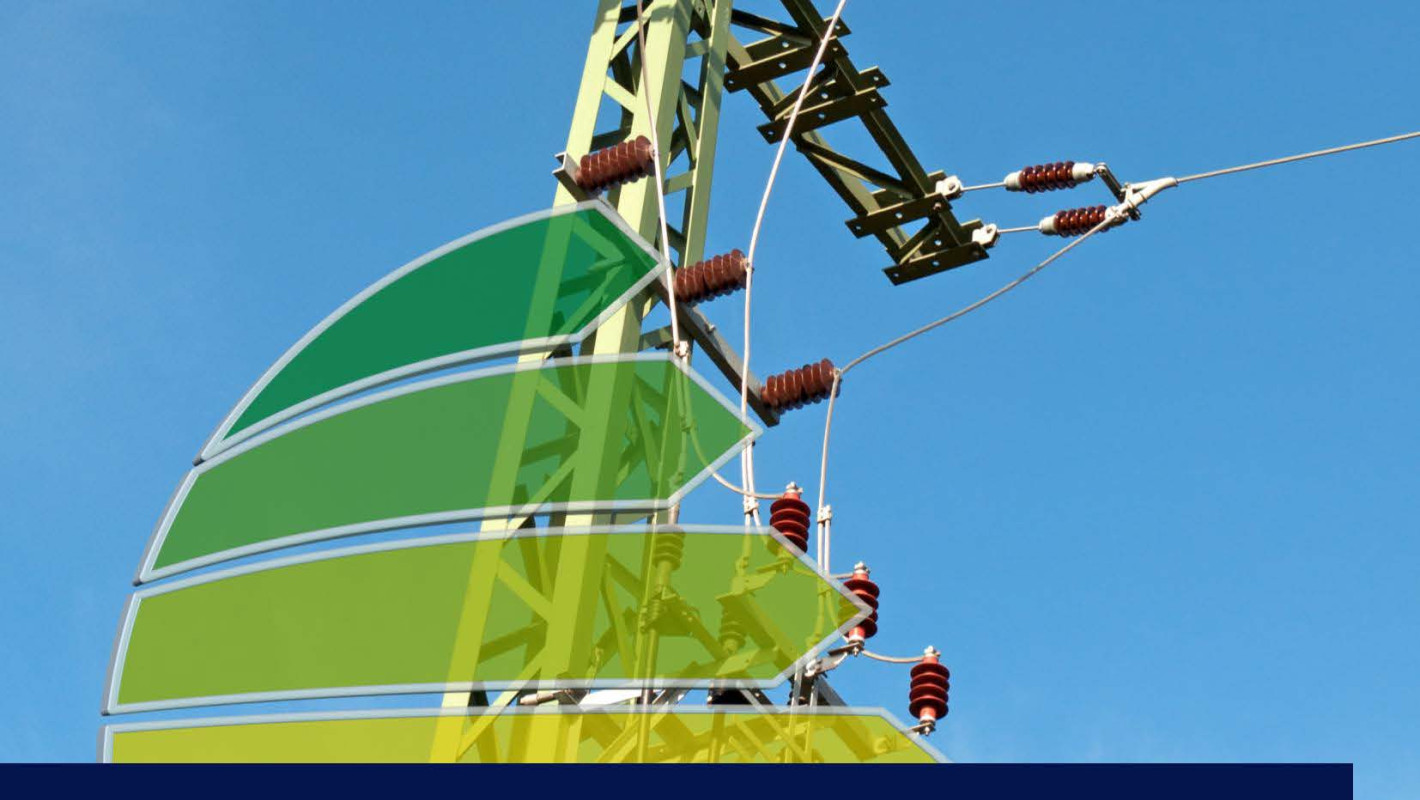US-Wirtschaftspolitik: Auswirkungen auf Wirtschaft und Finanzmärkte in Europa


Ein halbes Jahr nach Amtsantritt der neuen US-Administration unter Donald Trump sind die Auswirkungen auf Unternehmen und Märkte in Deutschland und Europa spürbar. Die wirtschaftspolitische Entscheidung der US-Regierung, mit Hilfe von Zöllen die industrielle Produktion in den USA zu steigern, führte zu Irritationen und teilweise Disruptionen in den internationalen Handelsbeziehungen. Donald Trump folgt dabei in großen Teilen dem Programm, das er vor der Wahl als „America-First-Strategie“ angekündigt hatte.
Zölle schaden den Wirtschaftsbeziehungen
Insbesondere der lange gärende Zollkonflikt wirkte sich unmittelbar auf viele Unternehmen hierzulande aus. Höhere Zölle widersprechen dem Wettbewerbsprinzip, schwächen längerfristig das Innovationspotenzial und schaden letztlich allen Seiten. Eine Rück-Verlagerung von Industrieproduktion in die USA zeichnet sich – zumindest auf absehbare Zeit – nicht ab. Mit der jüngst getroffenen Vereinbarung zwischen Trump und von der Leyen (27.7.2025) wurde eine pragmatische Lösung gefunden und eine weitere Eskalation vermieden. Dies sollte bis auf Weiteres wieder mehr Ruhe in die Wirtschaftsbeziehungen bringen. Es wird sich zeigen, wie sich dies auf die Handels- und Investitionsbeziehungen auswirkt.
Auch mittelbar, über die Entwicklungen an den Finanzmärkten, sind Unternehmen und die Gesamtwirtschaft von der US-Wirtschaftspolitik betroffen. Hier kommen weitere wirtschaftspolitische Maßnahmen der US-Regierung ins Spiel, die – so die Einschätzung vieler Kapitalmarktakteure – tendenziell die längerfristigen Perspektiven für das Wirtschaftswachstum in den USA trüben. Dazu gehören etwa die zunehmenden Knappheiten im Arbeitskräftepotenzial sowie die Aussicht auf dauerhaft hohe Defizite bei den Staatsfinanzen. Diese Entwicklungen sorgen für einen skeptischeren Blick der internationalen Investoren auf den Dollar-Raum.
Der US-Dollar verliert an Wert – bleibt aber führende Leitwährung
Mit der Abwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro verteuern sich europäische Exporte in die USA und auch in andere Länder, sofern sie in US-Dollar beglichen werden. Es ist auch möglich, dass der Dollar gegenüber dem Euro noch weiter an Wert verliert. Die US-Regierung hat signalisiert, einem schwächeren Dollar nicht entgegenwirken zu wollen. Kursveränderungen an den Devisenmärkten – auch beim Euro-USD-Kurs - hat es allerdings auch in der Vergangenheit geben.
Die Rolle des US-Dollar als weltweit führende Leitwährung steht damit noch nicht in Frage. Obwohl der US-Dollar in den letzten Jahrzehnten zugunsten anderer Währungen leicht an Anteil verloren hat, bleibt er weiter mit Abstand führend als globale Reserve-, Handels- und Absicherungswährung. Ein umfassender Ausverkauf scheint angesichts der enormen Breite und Tiefe des US-Finanzmarktes unwahrscheinlich – nicht zuletzt mangels echter Alternativen und aufgrund der begrenzten Marktvolumina anderer Anleihemärkte.
US-Bonds mit Preisaufschlägen
Die US-Staatsanleihen verzeichneten in diesem Jahr Preisaufschläge. Damit reagierte der Kapitalmarkt auf die von der neuen US-Wirtschaftspolitik ausgelösten Unsicherheiten sowie die perspektivisch weiter zunehmende Staatsverschuldung. In der Folge müssen die USA höhere Zinsen für ihre staatliche Schuldenaufnahme bezahlen. Diese Reaktion des Kapitalmarktes führte wiederum im Frühjahr offenbar zu einer – zumindest vorübergehenden – Zurückhaltung bei den US-Zollmaßnahmen.
Grundsätzlich dürfte die US-Staatsverschuldung – nicht zuletzt durch die Steuergesetze des „One Big Beautiful Bill Act“ – weiter zunehmen und damit die Refinanzierung des US-Haushalts immer herausfordernder werden. Inwiefern die erwarteten Zusatzeinnahmen aus den US-Zöllen zur Schuldenreduzierung beitragen können, bleibt abzuwarten.
Verlagerung von Kapital nach Europa
Ebenso konnte – als Reaktion des Kapitalmarkts – in den letzten Monaten eine Verlagerung von Kapital beobachtet werden, teilweise raus aus den USA und rein nach Europa. Ungeachtet der Ankündigung der EU, auch (weiterhin) signifikant in den USA zu investieren, muss es gelingen, die Attraktivität der EU als Investitionsstandort dauerhaft zu stärken und vor allem den Binnenmarkt für Kapital – die Kapitalmarktunion – zu vertiefen.
US-Markt bleibt zentral – Stabilität wichtig
Trotz der wirtschaftspolitischen Entwicklungen der letzten Monate bleibt der US-Markt für deutsche und europäische Unternehmen weiterhin hochattraktiv – und umgekehrt. Das gilt nicht nur für Exporte, sondern insbesondere auch für Investitionen. Der US-Kapitalmarkt und der US-Dollar bleiben für das globale Finanzsystem zentral. Umso wichtiger ist es, dass mit der jüngsten EU-US-Vereinbarung eine Lösung im transatlantischen Konflikt getroffen werden konnte, die bis auf Weiteres für Stabilität sorgen dürfte. Eine Eskalation des Handelsstreits – womöglich auch über Zölle hinaus – würde allen Seiten schaden. Sinnvoll wäre grundsätzlich der Ausbau des transatlantischen Freihandels. Dieses Ziel sollte auf der politischen Agenda bleiben.
Stärkung der EU
Auch und gerade vor dem Hintergrund der jüngsten EU-US-Vereinbarung bleibt es Aufgabe der Politik in Deutschland und der EU, die EU resilienter und zukunftsfester aufzustellen, insbesondere
- die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu stärken,
- die Rahmenbedingungen für Investitionen zu verbessern,
- die Wirtschaftsbeziehungen mit anderen Partnern auszubauen,
- den EU-Kapitalmarkt und insgesamt den EU-Binnenmarkt zu vertiefen.
US-Wirtschaftspolitik: Auswirkungen auf Wirtschaft und Finanzmärkte in Europa
Kontakt

Dr. Hendrik Hartenstein
Leiter Unternehmensfinanzierung
Kontakt

Marc-Clemens Wecker
Unternehmensfinanzierung